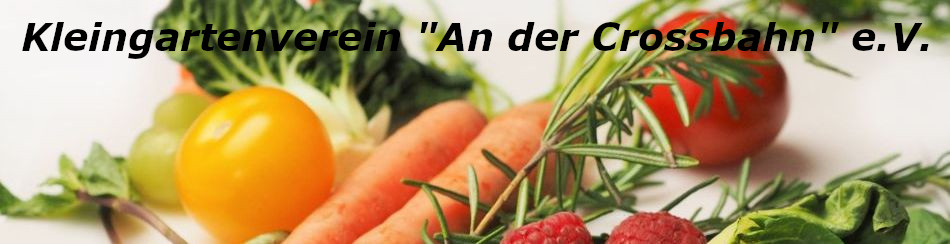Begriff Kleingarten
Zum Begriff Kleingarten und kleingärtnerische Nutzung
Die Auseinandersetzung mit einer Begriffsbestimmung ist erforderlich, da mit ihr oft eine
Verinnerlichung der Bedeutung des zu untersuchenden Gegenstandes erfolgt und dadurch das
mit dem Begriff bezeichnete Subjekt oder auch eine Tätigkeit genau charakterisiert wird. Im
konkreten Fall sind auch so Abgrenzungen zu anderen Rechtsverhältnissen und Rechts-
zuordnungen möglich. Die Begriffsbestimmung für den Kleingarten und die kleingärtnerische
Nutzung ist im § 1 des Bundeskleingartengesetzes (BKleingG) vorgenommen worden.
Trotzdem gab es dazu Meinungsverschiedenheiten. Die Rechtsprechung musste letztlich
Kriterien erarbeiten und dadurch auch definierend und erklärend eingreifen. Für den
Kleingärtner ist die Begriffsdefinition nicht nur für die tatsächlich auszuübende
Gartennutzung interessant, sondern vor allem für die sich daraus ergebenden
Rechtskonsequenzen, maßgeblich für den Pachtzins und die Kündigungsmöglichkeiten.
Maximalen Schutz hat der Kleingärtner und so auch begrifflich untersetzt nur, wenn sein
Garten dem BKleingG unterliegt.
Alle anderen rechtlichen Möglichkeiten, ob reiner BGB-Vertrag oder ein Vertrag nach
Schuldrechtsanpassungsgesetz sind hinsichtlich der Pachtzinsen, der Kündigungsmöglich-
keiten und weiterer Rechtskonsequenzen sowie Vertragsgestaltungsmöglichkeiten mit
Nachteilen verbunden. Dies betrifft vor allem auch Entschädigungsansprüche bei Beendigung
des Pachtverhältnisses. Diese Gärten unterliegen auch nicht der gesetzlichen
Begriffsbestimmung „Kleingarten“.
Gem. der Begriffsbestimmung eines Kleingartens (§ 1 BKleingG), sind zwei wesentliche
rechtsrelevante Umstände begriffserklärend zu nennen, die der jeweilige Nutzer des Gartens
maßgeblich selbst beeinflusst, wobei eine territoriale Mindestgröße in welcher der Garten
liegt erforderlich ist. Die Mindestgröße ergibt sich aus der Tatsache, dass ein Garten, um den
Status „Kleingarten“ erlangen zu können, in eine Anlage eingebettet sein muss, die sich aus
mehreren Einzelgärten (mindestens 5) zusammensetzt und gemeinschaftliche Einrichtungen,
die auch als solche genutzt werden, enthält. Der Garten selbst soll nicht übermäßig groß (ca.
400 m²) sein. Je kleiner sich die Anlage darstellt, d.h. je geringer die Anzahl der Gärten ist,
umso mehr werden diese Gemeinschaftseinrichtungen als Charakteristik einer Kleingarten-
anlage rechtsrelevant.
Die Rechtsprechung geht in dem Zusammenhang von einer besonderen Prüfungsrelevanz von
Kleingartenanlagen die 20 Kleingärten und weniger beinhalten aus. Grundsätzlich sind aber
Gemeinschaftseinrichtungen und deren Nutzung sowie Pflege durch jeden Kleingärtner
wichtig. Schaffung, Nutzung und Pflege von Gemeinschaftseinrichtungen ist eine von Klein-
gärtnern durch aktives Handeln beeinflussbare Charakteristika zur Begriffsbestimmung
D3/113-16
„Kleingarten“. Hier erlangt auch die Vereinstätigkeit, die in einem besonderen Beitrag erörtert
werden soll, eine hervorgehobene Bedeutung.
Als zweite begriffserklärende Größe des Begriffs „Kleingarten“ ist die individuelle Nutzung
durch den Kleingartenbesitzer zu nennen. Das heißt: Der Garten muss der im Begriff nicht
groß dehnbaren kleingärtnerischen Nutzung unterliegen. Diese beinhaltet als charakteristische
Merkmale
- die nicht erwerbsmäßige Nutzung
- die gärtnerische Nutzung zur Gewinnung von Gartenbauerzeugnissen für den
Eigenbedarf und
- die gärtnerische Nutzung zur Erholung.
Als Gartenbauerzeugnisse werden Obst, Gemüse und andere Früchte in der Vielfalt der
selbigen verstanden. Die Charakteristika (bis auf den Erholungszweck) beziehen ihre
Herkunft aus den Ursprüngen des Kleingartenwesens. Sie haben ihre Wurzeln in den Armen-
gärten, die dem Nutzer und seiner Familie der Versorgung mit gesunden Gartenbauerzeug-
nissen (Früchten) dienten und der Heranführung an die Natur und körperlichen gesunden
Bewegung (Schrebergärten).
Der Erholungszweck ist erstmalig gleichberechtigt mit der Inkraftsetzung des BKleingG im
Kleingartenwesen als Charakteristika aufgenommen worden. Die kleingärtnerische Nutzung
im Sinne des Obst- und Gemüseanbaus muss dabei flächenmäßig ein Mindestmaß erreichen,
um die durch das Gesetz geforderten begrifflichen Voraussetzungen zu erfüllen. Noch in den
1990er Jahren wurde dieses Mindestmaß vielfach mit über 50 % der Kleingartenfläche
angegeben. Durch Urteil des Bundesgerichtshofes vom 17.06.2004, Az. III ZR 281/03 ist als
gesichert anzusehen, dass mindestens ein Drittel der Fläche in der Kleingartenanlage dieser
Nutzung unterliegen sollte, um den Status zu erhalten.
Auch Kriterien wie die Bebauung, die rechtlich geregelt ist, oder durch Rechtsprechung
fixierte Grundlagen wie z.B. der Nutzungszustand am 3.10.1990 haben Einfluss auf den
Status „Kleingartenanlage“.